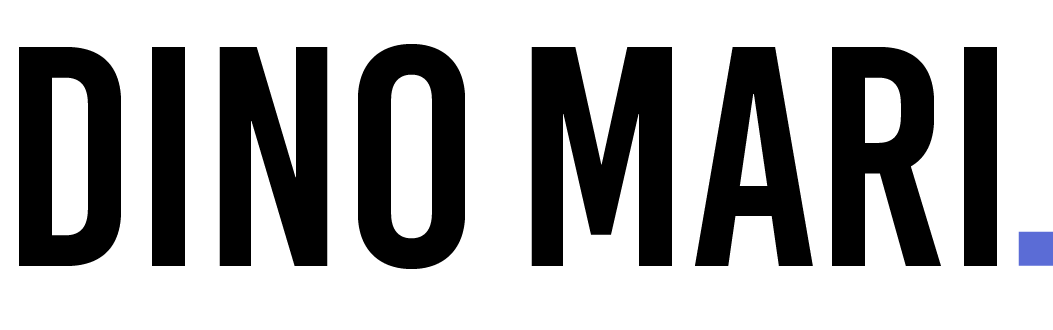Unter Uns
Die Gruppe aus Studenten und Dozenten traf sich in einem abgelegenen Nebengebäude der Hochschule in Deutschland. Nach einem prüfenden Blick in die Runde sagte ein Dozent: „Wir sind unter uns.“ Die Gruppe zögerte, warf beinahe reflexhaft Blicke über die Schultern. Der Dozent lächelte: „Wir können also frei sprechen.“
Im Gegensatz dazu handelte Elfriede Scholz jedoch unvorsichtig. Als Schneidermeisterin zweifelte sie offen am Krieg und sah in den Soldaten nur Opfer – Schlachtvieh einer untergehenden Ideologie. Kunden denunzierten sie, es folgten Haft und Anklage wegen Wehrkraftzersetzung. Am 16. Dezember 1943 fällte Roland Freisler, Präsident des Volksgerichtshofs, sichtlich befriedigt das Todesurteil – ein Racheakt an der Schwester des emigrierten Erich Maria Remarque. In Berlin-Plötzensee wurde sie enthauptet, ihr Körper der Forschung überlassen.
Kritik kann lebensgefährlich sein.
Die katholischen Geistlichen Johannes Schulz und Josef Zilliken verweigerten den „deutschen Gruß“ und wurden daraufhin auf persönliche Veranlassung Hermann Görings zur Lagerhaft verurteilt. Dort mussten sie täglich einem eigens aufgestellten Gesslerhut den verhassten Gruß erweisen – eine groteske Farce der Unterwerfung. Beide überlebten die unmenschlichen Bedingungen der Lager nicht.
Der unangepasste ist bereits Feind genug, um mit dem Tod bedroht zu werden.
Wer sich ideologischen Utopien nicht sichtbar unterwirft, lebt gefährlich – auch in der DDR, wenn auch weniger wahnhaft, weniger mörderisch. Konformität war Pflicht, Kritik tabu. Private Nischen und heimliche Netzwerke boten Freiräume, doch Denunziation – oft aus der eigenen Familie – lauerte stets. Öffentliche Kritik gefährdete nicht nur den Einzelnen, sondern auch sein Umfeld – Kontaktschuld als moderne Sippenhaft.
Ich wuchs in den 1980er Jahren tief im Westen der Bundesrepublik Deutschland auf – in einer Bonner Republik, die sich noch als Schaufenster des freien Westens verstand, während jenseits der Mauer sprichwörtlich uniforme Konformität herrschte. Als Teenager in einer Ära des Neons, der Musikvideos und kraftstoffgeschwängerter Maskulinität schien ein Rückfall in totalitäre Strukturen der deutschen Vergangenheit ebenso unvorstellbar wie eine kommunistische Expansion unwahrscheinlich.
Dennoch kam der Zusammenbruch der DDR plötzlich. Das totalitäre System feierte noch kurz seinen Jahrestag und implodierte im Anschluss in Rekordzeit, zurück liess es ein marodes Land, verschmutzt und heruntergekommen, voller Ungewissheiten und verlorener Menschen.
Die Freiheit triumphierte nicht, es gab keine Paraden, keine Verfolgung der Unterlegenen. Sie setzte sich ohne Blutvergießen – gegen ein gewaltbereites System – unaufgeregt, fast bürokratisch auch als Folge einer unbedachten Verordnung durch. Umso erstaunlicher, dass ich mich heute, Jahrzehnte nach dem Fall beider deutscher Staaten, in einer Berliner Republik wiederfinde, die Freiheiten mit beunruhigender Leichtigkeit abbaut.
Eine Republik, die Angst wieder als Herrschaftsmittel entdeckt zu haben scheint. Früher dienten Bolschewismus und Imperialismus als Bedrohungsszenarien, heute sind es Klimawandel, Pandemien oder geopolitische Spannungen – oft mit dem Ergebnis, dass bürgerliche Freiheiten beschnitten und liberale Selbstverständlichkeiten genommen werden.
Das Gefühl, konspirativ über die Schulter zu blicken, bevor man offen spricht, erinnert unangenehm an eine Vergangenheit, die ich lange als abgeschlossen betrachtete. Diese neue Vorsicht in der öffentlichen Diskussion – das Abwägen jedes Wortes aus Angst vor Missverständnissen oder negativen Konsequenzen – steht im Widerspruch zu der Offenheit und Freiheit, die meine Jugend prägte. Es ist mehr als nur besorgniserregend, dass die Meinungsfreiheit, einst ein Eckpfeiler unserer Gesellschaft, zunehmend unter Druck gerät – eine Entwicklung, die nicht nur gefühlt ist sondern sich auch in empirischen Umfragen unzweifelhaft nachweisen lässt.
Und so blicke ich mit sentimentaler Betrübnis auf die selbstverständlichen Freiheiten meiner Jugend in den 80er Jahren zurück. Es beunruhigt mich, wie schnell sich scheinbar stabile Gesellschaften verändern können – und wie vorsichtig man in Folge offenbar mit Worten und Meinungsäußerungen umgehen muss. Auch wenn man nicht mittelbar für so etwas banales wie Kritik nicht wie Elfriede Scholz um sein Leben bangen muss, kann ein achtlos geteiltes Meme durchaus zum Besuch eines Rollkommando im Morgengrauen führen.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie schnell sich Gesellschaften verändern können – und dass gerade der Verzicht auf Kritik diese Entwicklung nicht nur begünstigt, sondern oft erst ermöglicht. Nur wenige haben den Mut, aufzustehen und sich – trotz der Gefahr gesellschaftlicher Ächtung – gegen das jeweilige Narrativ des Zeitgeists zu stellen. Viele ziehen sich zurück – sei es in ein echtes Exil oder in eine neue Form des Biedermeiers, in private Rückzugsräume, in geistige Schrebergärten, die als heile, unpolitische Welten dienen.
Ich möchte fotografisch jene porträtieren, die allzu leicht als „umstritten“ etikettiert werden – oft als erster Schritt zur Ausgrenzung, ebenso als unterschwellige Drohung für all jene, die sich im Umfeld nicht zurückziehen. Es sind Autoren, Publizisten, Künstler, Wissenschaftler, Politiker oder schlicht Menschen, die sich dem vorherrschenden Strom nicht fügen wollen. Was sie eint, ist nicht nur ihre Unabhängigkeit des Denkens, sondern auch die Bereitschaft, dafür ein persönliches Risiko einzugehen – ein Risiko, zu dem ich selbst nicht bereit war.
Gerade deshalb ist dieses Projekt für mich auch ein Ausdruck der Wertschätzung. Diese Menschen setzen ihre Reputation, ihre berufliche Existenz oder gar ihre sozialen Bindungen aufs Spiel, um an Überzeugungen festzuhalten, die sie als wahr empfinden. Ihre Standhaftigkeit verdient es, sichtbar gemacht zu werden – nicht als Provokation, sondern als Dokumentation und als Zeichen des Respekts.
Doch dieses Projekt ist nicht nur eine Dokumentation, sondern auch eine Einladung: eine Einladung zum Nachdenken über die Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung und darüber, was es bedeutet, sich dem Mainstream zu widersetzen. Es ist der Versuch, jenen ein Gesicht zu geben, die sich nicht in die vorgegebenen Erzählungen fügen – sei es aus Überzeugung, aus intellektueller Redlichkeit oder schlicht aus dem Bedürfnis nach Wahrheit.
Ihre Gesichter, ihre Umfelder, ihre Körperhaltung erzählen von Widerstand und Einsamkeit, von Mut und Zweifel, von Verlust und Hoffnung. In einer Zeit, in der Konformität zur Tugend erklärt wird und Widerspruch als Gefahr gilt, sind diese Porträts ein stiller, aber entschiedener Einspruch.
Ergänzt werden diese Porträts durch Fotografien jener, deren Lebensleistung sich ob der Veränderungen um sie herum in Frage gestellt sieht, oder die sich in unpolitische Realitäten des Vereinslebens oder Sports geflüchtet haben. Das Private, die Nische als aktionsgeladener Biedermeier der Neuzeit.
Die Fotografie hält fest, was Worte oft nicht ausdrücken können: den Moment der Unbeugsamkeit und vielleicht auch den Preis, den sie dafür zahlen.
.