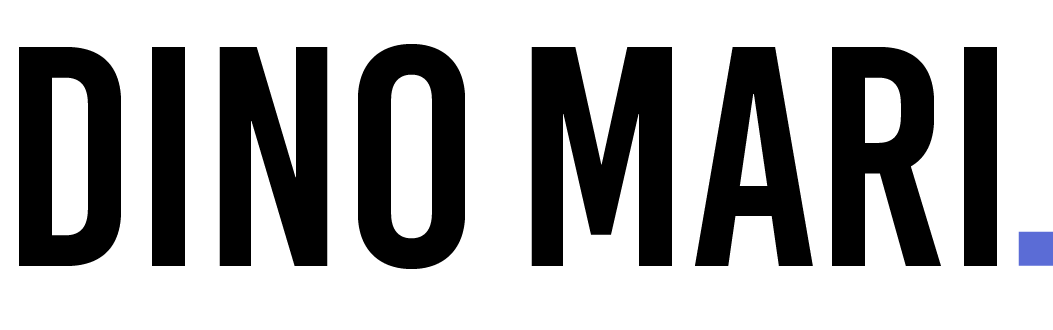Fotografie zwischen Simulation und Realität
Walter Ulbricht, Leipzig, 15.8.59 - Bundesarchiv, Bild 183-66400-0142 / CC-BY-SA 3.0
In der Montagsausgabe des Neues Deutschland vom 10. Oktober 1989 finden sich im Rahmen der Berichterstattung zum 40. Jahrestag der DDR 26 Bilder von Erich Honecker. Diese Zahl liegt zwar deutlich unter der Rekordmarke von 47 Bildern in einer einzigen Ausgabe des ND am 16. März 1987, doch stellt sie dennoch das letzte gehorsame Aufbäumen des Haltungsjournalismus der DDR dar. Bereits am Folgetag begannen die ersten wütenden Berichte über „Provokationen“ und „Rowdies“, die das unmittelbar bevorstehende Ende des Mauerstaates einläuteten.
Lotte und Walter Ulbricht im Tal der Könige, 27.2.1965. Bundesarchiv, Bild 183-D0227-0053-004 / CC-BY-SA 3.0
In den vier Jahrzehnten zuvor hatte die Fotografie der DDR den systemimmanenten Totalitarismus hinter einer Fassade kleinbürgerlichen Kitsches verborgen. Sterbenslangweilig und repetitiv zeigten die immer gleichen Motive glücklicher Menschen, geführt von ebenso klugen wie verantwortungsvollen Funktionären. Neben der ikonografischen Überhöhung Stalins als Säulenheiliger der Republik war es zunächst Walter Ulbricht, der sich – neben der offiziellen Darstellung des politischen Alltags – gern als nahbarer Landesvater inszenierte, ob am Frühstückstisch, bei der Gymnastik oder wissensdurstig auf Reisen in exotische Länder.
Im Anspruch ebenso absolut und totalitär wie das Regime zuvor sah sich die Fotografie in der DDR gezwungen, einen aus eben dieser jüngeren Vergangenheit sattsam bekannten Kollektivismus neu zu inszenieren und sich doch gleichzeitig auch optisch vom Dritten Reich unterscheiden zu müssen. Die gleichen Straßen, die gleichen Umzüge und Paraden, nun mit nur moderat anderen Uniformen und Symbolen, galt es als neu und vor allem antifaschistisch zu interpretieren. Dies gelang durch eine beinahe schon im Übermaß betonte Provinzialität: Der Totalen Riefenstahls folgte ein bescheidenes Klein-Klein, das sich rasch im grauen Alltag im „demokratischen“ Deutschland wiederfand – dem idealisierten Pathos des Nationalsozialismus folgte die Tristesse im neuen Sozialismus, in Bild und gelebter Realität.
Erich Honecker in Lusaka, 20.2.1979
© Bundesstiftung Aufarbeitung/Harald Schmit
So langweilig oder mindestens gleichförmig die Bilder auch waren, so sicher und fest in staatlicher Hand waren jedoch die Distributionskanäle. Der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst (ADN) versorgte das seit spätestens 1953 gleichgeschaltete ostdeutsche Mediennetz mit einer steten Flut sorgsam ausgewählter „richtiger“ Bilder. Eine offizielle Medienzensur fand zwar nicht statt, allerdings bedurfte es staatlicher Lizenzen, um überhaupt publizieren zu dürfen. Lizenzhalter, die unangenehm auffielen oder dem jeweils aktuellen Dogma des Staates zuwiderliefen, wurden durch Streichung aus dem sogenannten Postzeitungsvertrieb jedweder Verbreitungsmöglichkeiten beraubt, was einem Verbot gleichkam. Oder es wurden einfach Papierzuteilungen gestrichen oder schlicht keine Steuernummer erteilt – der Eingriff in die Freiheit als Verwaltungsakt. Offiziell jedoch fand in der DDR – und bis vor kurzem in der BRD – keine Zensur statt, zu übermächtig die Angst auf beiden Seiten, wieder als ein Unrechtsregime wahrgenommen zu werden.
Der stete Niedergang konventioneller Medien mit den Nachrichten und Bildern von gestern geht mit der unmittelbaren und grundsätzlich unbegrenzten Verfügbarkeit digitaler Inhalte einher. Text und Bewegtbild sind ebenso wie die Fotografie nicht mehr den Regeln der analogen Distribution unterworfen, was zu einer unvergleichlichen Medienflut geführt und ganz notwendigerweise eine immer kürzere Achtsamkeitsschwelle im Sinne einer privaten Aufmerksamkeitsökonomie zur Folge hat. Dabei ändern sich Wahrnehmung und Wert der Bildmedien rasch; wo ein bemerkenswertes Porträt von Winston Churchill durch Yousuf Karsh 1941 durchaus noch einen gewissen Einfluss auf die Geschichte gehabt haben mag, ist die politische Bildkommunikation heute ebenso belanglos wie jene im Sozialismus geworden – es werden, wie in der DDR, die stets gleichen Bildmuster wiederholt, nur die Staffage und der Hintergrund ändern sich.
Aussenministerin Annalena Baerbock auf dem Weg zu einer PK vor dem Kapitol. 13.9.2023, Washington (dpa / Michael Kappeler)
Winston Churchill nach seiner Rede vor dem kanadischen Parlament (“Some Chicken, Some Neck”), fotografiert von Yousuf Karsh am 30.12.1941.
Dass es bei dieser Form der inflationären Bilderproduktion zu ungewollt komischen Ergebnissen kommen kann, bewies vor kurzem die Bundesministerin des Äußeren, Annalena Baerbock, im Rahmen einer Kurzvisite in Washington. Eine unglücklich gestellt wirkende Fotografie zeigt Frau Baerbock forschen Schrittes vor dem Kapitol, auf dem Weg zu einer Pressekonferenz mit der Kuppel des Kongresses als bedeutungsschwangeren Hintergrund. Eine Inszenierung, sowohl inhaltlich als auch fotografisch, die trotz dramatischem Backdrop sich nur schwer mit politischen Porträts der Vergangenheit messen kann. Die bereits angesprochene Fotografie Churchills entstand in einem Hinterzimmer des kanadischen Parlaments, doch so profan die Umgebung, so gehaltvoll die Rede zur Hochzeit der japanischen Expansion im Pazifik. Im Vergleich dazu reduziert sich die moderne politische Kommunikation auf mäßiges Influencer-Niveau, das Medium macht die Nachricht und ersetzt Inhalte durch visuelle Stimuli. Nebenbei hat Frau Baerbock als erste deutsche Außenministerin mit eigener Stylistin, eigenem Fotografen und einer unmittelbar zuarbeitenden Bildagentur ihr öffentliches Bild bemerkenswert hoch priorisiert.
Albert Speer, Adolf Hitler und Arno Breker auf dem Trocadéro vor dem Eiffelturm. Davor ein Kameramann für die Wochenschau. Paris, 23.6.1940.
NARA National Archives and Records Administration, Vereinigten Staaten.
Dass sich dabei diese – wie auch zahllose andere aktuelle Bildinszenierungen nicht nur von Frau Baerbock – sehr an der unglücklicherweise universell wirksamen Bildrhetorik eines Heinrich Hoffmann orientieren, mag nur wenig überraschen. Es waren Hoffmann und Riefenstahl, die das Theater der Macht perfektionierten, mit Hitler als Brennpunkt eines fiebrigen Fanatismus. Der Führer war dabei stets in Bewegung, im Flugzeug, der Eisenbahn, dem Auto. Oder er bewegte sprichwörtlich die Massen, zu Jubelstürmen oder Aufmärschen, zog sie in seinen Bann mit ihm im Zentrum der Begeisterung. Nur selten, in besonderen Momenten, gestattete er sich und seinen Zuschauern sorgfältig inszenierte Momente der Ruhe, so beispielsweise während seines persönlich wohl größten Triumphes nach der Niederlage Frankreichs. Bei seinem morgendlichen Besuch des noch schlafenden Paris zeigen die Bilder ihn in rascher Folge vor den Wahrzeichen der Hauptstadt wie auch der Nation Frankreichs, um mit einem Foto eines „nachdenklichen“ Hitlers mit dem Eiffelturm im Hintergrund zu enden – ein in jeder Beziehung perfekter Vorgriff auf die privaten wie auch politischen Reise-Inszenierungen in der Jetztzeit.
Raising the Flag on Iwo Jima, 23.2.1945, Joe Rosenthal
Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump, umgeben von Agenten des SecretServices, unmittelbar nach dem Attentat. 13. 7. 2024, Butler, Pennsylvania. (AP Foto/Evan Vucci)
Doch bei allem Belanglosen, Furchtbaren oder Lächerlich-Inszenierten müssen die Bildikonen der Vergangenheit, ob Karshs Churchill von 1941 oder Brandt in Warschau, gelegentlich auch neuen Motiven Platz machen. Seien es Bilder von den Massakern der Hamas oder die Fotografie Donald Trumps unmittelbar nach dem nur um Haaresbreite missglückten Attentat von Butler, die gleichzeitig dem Talent eines Delacroix als auch dem kollektiven Bildgedächtnis des amerikanischen Nationalmythos von Iwo Jima entsprungen zu sein scheinen. Evan Vucci’s Fotografie zeigt – ungeachtet aller Differenzen und Theorien um den gescheiterten Anschlag und die Person Donald Trump – unmittelbar die ungebrochene Wirkmacht des Mediums Fotografie. So wirksam, dass zahlreiche Medien und Nachrichtendienste in den USA und Deutschland, davon Abstand genommen haben, sie als unzweifelhaft verdienten Aufmacher zu nutzen. Denn nicht jeder mag sehen, was tatsächlich geschehen ist – vielen ist das Simulacrum schöner Bilder auf Instagram lieber, besonders dann, wenn es die eigenen Vorurteile nicht beschädigt.