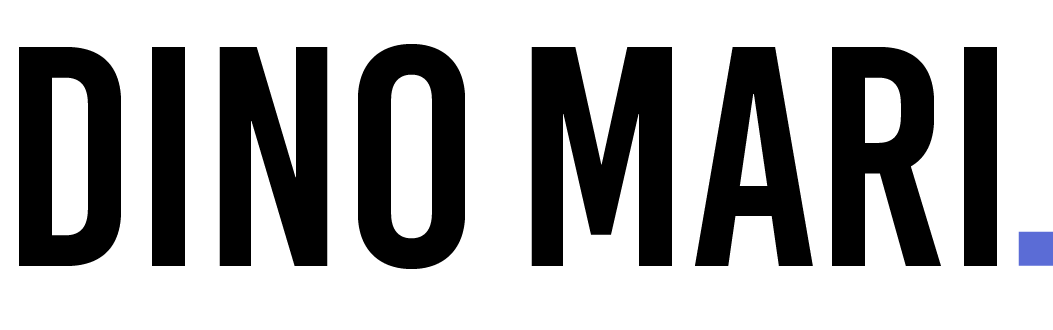Das Problem mit der Fotografie
Das Problem der Fotografie liegt im Detail - und warum s/w auch nur eine Variante der Unschärfe ist.
Keine Details!
Mit der Fotografie ist das so eine Sache, sie ist fleißig und zeichnet unterschiedslos auf was ihr vorgehalten wird. Der Kollege und Publizist Andreas Jorns hat vor einiger Zeit das schöne Bonmot von „Schärfe gibt es beim Inder“ geprägt. Eine griffige Replik auf eine sich zumeist rein auf die Technik beschränkende Lesart der Fotografie, verweist aber darüber hinaus auf eine bereits sehr früh erkannte Besonderheit der fotografischen Abbildung: Ihre Fähigkeit gleichsam automatisch alles an optischen Eindrücken einzusammeln, ungeachtet ob nun relevant für das gewünschte Bildergebnis oder nicht. Die Fotografie ist halt nicht nur surreal, sie neigt auch dazu besonders fleißig im Sammeln von Eindrücken zu sein.
Seit der ersten Fixierung von Lichtstrahlen – Niépces Heliografie – waren nur wenig mehr als 15 Jahre vergangen, in denen aus noch sehr vagen Schemen präzise reproduzierte Daguerreotypien wurden. Unikate allesamt, das in Ihnen enthaltene Flächenbild nur in idealem Winkel und Licht preisgebend. Dann jedoch im Überfluss, und dank des Glasträgers auch unnachahmlich dimensional, mit feinem Gespür für eben jedes noch so kleine Detail.
Doch mitunter vermittelt die Fotografie zu viel davon, ist geschwätzig und flegelhaft wo leise Töne und aristokratische Größe (Gott schütze Den König!) angezeigt wären. Jedoch wurde sie zunächst noch sehr dafür gefeiert, dass sie es dem Licht erlaubt, ganz genau und ohne Rücksicht alles aufzuzeichnen – oder gar den Dingen sich selbst aufzuzeichnen: „Jetzt kann man den Türmen von Notre Dame befehlen: „Werdet Bild“ und die Türme gehorchen (Jules Janin, Der Daguerreotyp, 1839). Oder William Henry Fox Talbot 1844: „Das Instrument registriert, was immer es auch sieht, und sicher würde es einen Kamin oder einen Kaminfeger mit der gleichen Unparteilichkeit wie den Apoll des Belvederes aufzeichnen.“
Gleichzeitig stellte sich jedoch auch die Frage, was dieses chemisch-mechanische Hexenwerk denn überhaupt sei; ein neues Handwerk bestenfalls oder gar neue Kunstform, Fotografen zukünftig gleichberechtigt neben Bildhauern und Malern? Delacroix bezieht sich auf den mechanischen Realismus der Fotografie, wenn er seinen Kunstbegriff wie folgt summiert: „Der große Künstler konzentriert das Interesse, indem er die unnützen und dummen Details unterdrückt“. Es ist also die Aufgabe des Künstlers das Auge des Betrachters zu lenken und nicht ziellos über das Motiv irren zu lassen. Und weiter: „Die Fotografien, die uns am meisten fesseln, sind jene, in denen die Aufzeichnungsmängel des Prozesses gewisse „Freistellen“ gelassen haben, an denen das Auge Ruhe findet und sich auf nur wenige Gegenstände konzentrieren kann.“
Die Fotografen jeder Zeit – allesamt Parvenüs, so der deutsche Kunsthistoriker Wolfgang Kemp – wollen aber meist Künstler sein, keine Handwerker. Und während sich die Fototechnik stetig weiterentwickelt, deren neue Objektive schärfer zeichnen, Papiere und Bäder besser reproduzieren – beginnen bereits in den späten 50er Jahren des 19. Jahrhunderts Fotografen mit der Unschärfe zu experimentieren.
War die Fotografie in ihren Anfängen noch von einem naturwissenschaftlichen Ideal geprägt, wandte sie sich nun schnell der Kunstfotografie zu. Im Atelier hatte sich die Notwendigkeit der Überarbeitung störender Details durch Retusche bereits schnell durchgesetzt, ein Trend, der sich schon bald in Richtung völliger Idealisierung verstärken würde. William John Newton empfahl seinen Kollegen bereits 1853 eine leicht unscharfe Einstellung. Peter Henry Emerson empfiehlt mit seiner „Out-of-Focus“-Theorie 1886 ebenso wie Newton eine leichte Unschärfe, beruft sich dabei aber auf die Wahrnehmungsphysiologie des deutschen Naturforschers von Helmholtz. Demnach liefert das menschliche Auge nur am jeweiligen Fokuspunkt ein scharfes, an allen anderen Stellen jedoch ein unscharfes Bild. Die Fotografie ahmt also auf ihrem Weg zur Kunst zunächst das menschliche Sehen nach. Emerson liefert damit auch die Grundlagen der aufkommenden bildmäßigen Fotografie, einer Fotografie „wie gemalt“ - die verträumt unscharfen Porträts von Julia Margaret Cameron sind ein gutes Beispiel für die Vermeidung von übermäßig vielen Details im Porträt ohne eine aufwändige Retusche. Die zunächst nur empfohlene moderate Unschärfe, einer Anpassung an vorhandene Hell/Dunkel Kontraste werden rasch durch extremere Formen der Bildbearbeitung in Richtung einer impressionistischen Fotografie überlagert.
Die bildmäßige Fotografie findet sich bis heute, sie hat sich allen modernen Strömungen stets erfolgreich wiedersetzt, oder sich mindestens daneben behauptet. Die Notwendigkeiten und Konventionen der der sozialen Medien fördern dies sehr, auch weil wir mittlerweile gewohnt sind die Motive ähnlich einer Daguerreotypie hinter Glas und in einem eher kleinem Format zu beurteilen. Das „piktoriale“ will schönes stets schön aussehen lassen, und trifft somit den Nerv der täglichen Bilderwartung im Westentaschenformat.
Dabei ist es mittlerweile eben nicht nur die Unschärfe, die sich üblicherweise als verträumtes (und teuer erkauftes) Bokeh äußert. Die Technik hat ihren Siegeszug ununterbrochen fortgesetzt, den Fotografen immer neue Möglichkeiten mit stetig verbesserte Abbildungsleistung geboten. Besonders bemerkenswert erscheint mir dabei das jede neue Kamerageneration mit immer verbesserter Detailfülle unter allen Bedingungen aufwartet, die dann jedoch in der Postproduktion auf das Äußerste beschnitten zu werden.
Somit ist auch die Rückgriff auf Formen der monochromen Fotografie – sowohl in klassischem s/w als auch in Farbe – ist ebenso nur eine Variante der Unschärfe, sowohl ästhetisch als auch kunsthistorisch.[1] Das gefällige, das piktoriale ist fast immer eine eher reduzierte Form der Kommunikation.
Eine grundsätzliche Gegenposition zum optischen Zuckerguss des bildmäßigen hat John Ruskin bereits im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vertreten. Tatsächlich findet sich auch heute neben dem insbesondere in der Amateurfotografie dominierenden piktoralem auch andere Positionen. Beispielsweise in der Modefotografie, die schon allein auf Grund der angestrebten Absatzbewegung vom Massenmarkt mitunter auf eine vollständig andere, vollständig konstruierte Bildwirkung setzt.
Eine praktische Lösung – oder zumindest interessante Übung – wäre die temporäre Verwendung eines Weitwinkels in Verbindung mit einer Blende 11. Auch wenn die Wahl des Objektives überraschend wenig mit der sogenannten Tiefenschärfe zu tun hat, ergeben sich bei der Kombination von geschlossener Blende, entsprechendem Aufnahmeabstand und großem Aufnahmewinkel eine ganze Reihe gestalterischer Herausforderungen die sich nur mit sorgfältiger Komposition und dem Einsatz eines Statives lösen lassen. Eine Arbeitsweise wie sie sich auch in der Autorenfotografie von Alec Soth und Joel Sternfeld findet; oder im strukturierten Vorgehen eines August Sander oder Eugene Atget.
Dennoch empfinde ich es als bemerkenswert wie sehr die moderne bildmäßige Fotografie dem Bildempfinden der vorletzten Jahrhundertwende entspricht, nur die „Looks“ sind mitunter dem Zeitgeschmack entsprechender. Eine immanente Reduktion, um besser wahrgenommen zu werden; ganz genau wie in den Anfängen der Fotografie.
Ein wunderweiches Bokeh ist nicht notwendigerweise künstlerisch, noch handwerklich besonders schwierig. Abblenden bis die böse Beugung kommt ist mitunter nicht verkehrt, manchmal sogar sehr angezeigt.
Dies nur als Anregung. Manchmal bringt das Detail, das Farbige, der Geschwätzige Diskurs die richtige Schärfe. Vindaloo statt Eintopf. 😉
Quellen:
Kemp, Theorie der Fotografie, Bd. 1 - https://amzn.to/3d8o9UG
John Ruskin - https://amzn.to/3Qz8hs4
Andreas Jorns - https://www.ajorns.com/luciddreams/
Aus meinem Bücherschrank:
Delacroix - https://amzn.to/3DmLJIe
William Henry Fox Talbot - https://amzn.to/3xg5i0T
Julia Margaret Cameron - https://amzn.to/3RWqSzm
Alec Soth - https://amzn.to/3qD0sqN
Joel Sternfeld - https://amzn.to/3qD0sqN
August Sander - https://amzn.to/3BCaIWo
Eugene Atget - https://amzn.to/3BdatQr
[1] Noch vor wenigen Jahrzehnten haben Ausstellungen, die auch Farbfotografien zeigten, ihre Besucher davor ausdrücklich gewarnt. Eine Farb-Trigger-Warnung sozusagen.