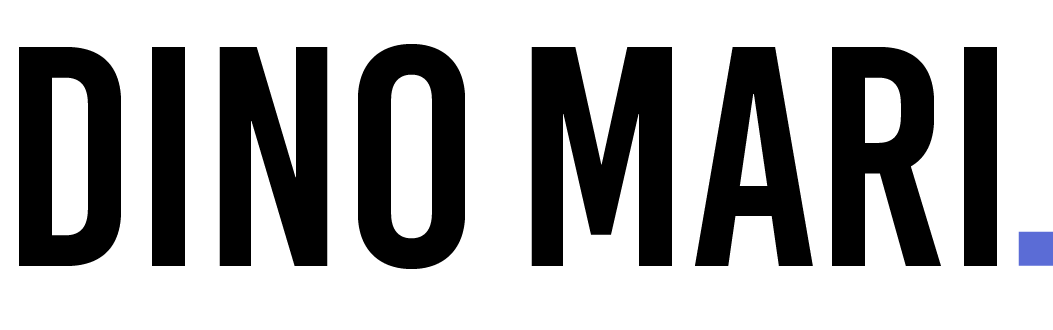Die Leiche bitte 40m nach rechts
Die Fotografie ist ein besonders charmanter Lügner, dem man gern auch groteske Retuschen abkauft. In ihren Anfängen war die Fotografie da deutlich bescheidener - und robuster. Ein kleiner Ausflug in die Anfänge der Bildmanipulation.
Alexander Gardner, Timothy H. O'Sullivan - Home of a Rebel Sharpshooter, Gettysburg aus Gardner's Photographic Sketchbook of the War, United States Library of Congress.
Mit der Fotografie war das auch früher schon so eine Sache.
Das Fotografien gefälscht werden, das Bilder lügen ist nicht neu. Die Fotografie ist jedoch ein besonders charmanter Lügner, denn selbst groteske Retuschen anatomischer Unmöglichkeiten werden vom Betrachter noch als glaubwürdig interpretiert. Wir vertrauen der Fotografie selbst dann, wenn wir die Manipulation erkennen, sei es aufgrund erkennbarer Bearbeitungsspuren oder weil der Verstand eben sehr genau weiß, dass kein Licht der Welt die Zeichen der Zeit besiegen kann. Es ist jener besondere Charme der fotografischen Maschine, der uns an einen emotional wahrhaftigen Kern im Bild glauben lässt, unabhängig davon, ob es sich um das Portrait eines Politikers, ein idealisiertes Modelfoto oder einen farbenprächtigen Sonnenuntergang handelt.
Zumindest was Manipulationen angeht, war die Fotografie in ihren Anfängen jedenfalls noch deutlich bescheidener.
Die erste offizielle Bildreportage aus einem Kriegsgebiet – dem der Krim, einer Region, in der heute wie damals Eroberer und Eroberte minimal zur Fertilität des Bodens beitragen – stammt wohl von Roger Fenton (1819-1869). Dieser Krieg hatte insbesondere aufgrund einer miserablen Versorgungslage der kämpfenden Truppe eine schlechte Presse, nicht zuletzt deswegen beauftragte die britische Krone Fenton mit der fotografischen Dokumentation des Konfliktes. Fenton lieferte dann konsequenterweise eine dem Geschmack der Auftraggeber entsprechende Darstellung dieses kleinen Konfliktes großer Mächte. Das tatsächliche Elend, insbesondere das massenhafte langsame Sterben an Verwundung und Krankheit, fand dagegen seinen Weg nicht auf die Mattscheibe Fentons.
Neben den von der Krone gewünschten erbaulichen Abbildungen aufrechter Kämpfer hat insbesondere die Fotografie des „Tal des Todes“ ihren Weg in das kollektive Bildgedächtnis des Westens gefunden. Ein karges Tal nahe Balaklawa [1], in dem eine englische Kavallerie Brigade dank des fahrlässigen Unvermögens des kommandierenden Generals von russischer Artillerie zusammenkartätscht wurde.
Die „Attacke der leichten Brigade“ war ob Ihrer Tragik wie auch der hohen Verluste innert kürzester Zeit berühmt und ist im englischen Sprachraum bis heute sprichwörtlich legendär. Fenton besuchte den – vermutlichen – Ort des Geschehens erst einige Zeit später und fertigte zwei Fotografien an, beide von einem identischen Aufnahmestandpunkt. Die erste Aufnahme war offenbar nicht dramatisch genug; erst die zweite Belichtung schaffte es in die Zirkel der Macht in England. Der Unterschied liegt in den zahlreichen Kanonenkugeln die Fenton und sein Assistent bildwirksam zusammengetragen haben – und erst so für die richtige Gänsehaut beim Betrachter sorgten. Ohne die Kugeln haben wir das Landschaftsfoto eines kargen Tals auf der Krim; mit ihnen jedoch das Tal des Todes.
Waren es bei Fenton noch umdekorierte Eisenkugeln des Krimkrieges (1853-1856), sortierte Felice Beato (1832-1909) nach dem Sepoy-Aufstand in Indien (1858) bereits die Schädel getöteter Rebellen zugunsten eines aufmerksamkeitsstärkeren Bildes. Beato ist auch der erste, der mit den gefallenen Soldaten des zweiten Opium Krieges (1860) den kommenden Schockfotos des amerikanischen Bürgerkrieges vorgreift. Das es sich bei diesen sehr frühen Abbildungen getöteter Soldaten selbstverständlich um die der Gegenseite und nicht jene der europäischen Mächte Englands und Frankreichs handelte, greift dabei ebenso zukünftig universellen Handlungsmustern vor.
Ein Jahrzehnt nach Fentons Bildern von der Krim war der amerikanische Bürgerkrieg der erste Krieg dessen Ereignissen über den Telegraphen tagesaktuell in das Hinterland übermittelt wurde, der erste moderne mechanisierte Konflikt in beinahe schon Echtzeit. Die noch junge Fotografie ermöglichte vielen einfachen Soldaten das eigene Portrait in Uniform, die Fotografen zogen den Armeen hinterher und produzierten Bilder, die sich als Reproduktion oder auch in Form der damals populären Stereographie vermarkten ließen. Neben Offizieren, Panoramen und Gruppen von Soldaten mit schwerem Gerät waren es auch Gefallene – wie bei Beato vorzugsweise die der Gegenseite – die ihren Weg vor die Linsen der Fotografen fanden.
Eine der bekanntesten dieser Fotografien zeigt einen getöteten Schützen zusammengesunken in seiner letzten Stellung, die Muskete lehnt noch aufrecht an der aus Steinen improvisierten Brustwehr. Der Betrachter mag hier einen Scharfschützen erkennen, der dort wohl schwer verwundet neben seiner Waffe verstarb, in seinen letzten Minuten sicher in Gedanken bei seiner Familie. Die Lage des Körpers, die Waffe, im Hintergrund die Brustwehr, all das „macht“ das Bild. Nur: so ist es eben nicht gewesen: Gestorben ist der junge Soldat nicht dort, und auch hier existieren wie bei Fenton zwei Belichtungen.
Am 5. Juli 1863 erreichte der Fotograf Alexander Gardner den Schauplatz der Schlacht von Gettysburg. Die Schlacht war zwei Tage zuvor beendet worden, viele Leichen noch unbestattet.
Als er am 6. Juli die Leiche eines konföderierten Soldaten in einem Gebiet namens „Devil’s Den“ sah, fotografierte er sie. Er und sein Assistent sahen dann eine Gelegenheit für ein weiteres, dramatischeres Foto. Sie bewegten die Leiche mehr als 40 Meter zu der Stelle, von der sie glaubten, dass sie die Position des Scharfschützen war, und machten eine weitere Belichtung.
Über 100 Jahre lang stellten Historiker die Bildunterschriften, die Gardner in seinem „Photographic Sketch Book of the Civil War“ schrieb, nicht in Frage. Diese beschrieben „…einen „Scharfschützen“, der eines langsamen Todes gestorben war und seine letzten Momente damit verbracht hatte, an seine Familie zu denken.“ Gardner schrieb auch, als er im November 1863 nach Gettysburg zurückkehrte, seien die Leiche und die Waffe immer noch dort gewesen. [2][3]
Der getötete Infanterist war an seinem ursprünglichen Fundort eine fotografische Kurzmeldung aus einem an Elend reichen Konflikt. In seiner inszenierten Form wurde er zur Geschichte, die Fotografie vermittelt nun mehr als nur eine Todesnachricht. Sie erzählt von Tapferkeit, von Agonie und Endlichkeit. So ist es gewesen, vielleicht nicht genau so aber doch sehr ähnlich, hunderttausendfach in Gettysburg ebenso wie in Antietam, Chancellorsville oder Vicksburg.
Wenn in der Malerei von Fälschungen gesprochen wird, geht es üblicherweise um die Urheberschaft. In der Fotografie beinahe immer um den Inhalt, den Wahrheitsgehalt. Dabei kann das surreale Medium Fotografie nie frei von Manipulation sein. Sie „framed“ immer, ist immer nur der kleine Ausschnitt einer größeren Geschichte. Die Kugeln Fentons, Beatos Schädel und Gardners Schockfotos haben den Gesellschaften jener Zeit die Augen öffnen wollen.
Eine Fähigkeit, eine Freiheit, die uns in einem zunehmend restriktiv kuratierten Umfeld auch leicht wieder verloren gehen kann.
Nächste Woche Dienstag geht es um die neue Bildhygiene, das antiseptische der sozialen Medien. Ich freue mich über jede Rückmeldung, Korrektur oder unflätige Beschimpfung. Schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Ihnen der Sinn nach Austausch steht.
Aus meinem Bücherschrank:
Im Text erwähnt und über Amazon-Partnerlink aufrufbar:
Alexander Gardner - https://amzn.to/3QWGrqI
Im Text nicht erwähnt, aber weil Krieg immer ein Elend ist:
Immanuel Kant - https://amzn.to/3cPIqyb
Karl R. Popper - https://amzn.to/3eqtPd7
Hannah Arendt -https://amzn.to/3CCzPcO
Leo Tolstoi - https://amzn.to/3pXzOIA
Erich M. Remarque - https://amzn.to/3D2h9mP
Manfred Gregor - https://amzn.to/3B92WlJ
[1] Ja, genau, daher der Name dieser auch heute noch populären Kopfbedeckung, eine der desolaten Versorgungslage geschuldete Improvisation.
[2] Sinngemäss übersetzt: Pieces of History, U.S. National Archives, Bruce Bustard.
[3] Es erscheint unwahrscheinlich das Körper und Waffe des getöteten Schützen einen derart langen Zeitraum auf dem von schon bald von Souvenirjägern heimgesuchten Schlachtfeld “überlebt” hätten.