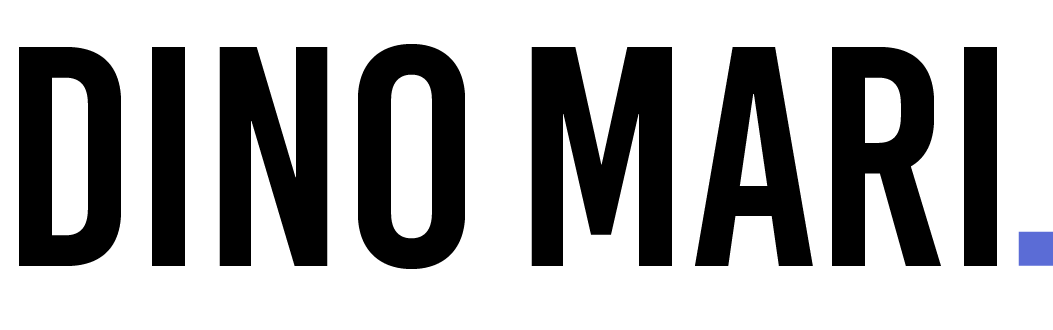Im Westen mehr Lametta
Wenn Bilder grösser als Leben und Sterben sein wollen
Postkarte, 2014. Deutschland links, England rechts.
Mit der Fotografie wie mit dem Film ist das so eine Sache, es zählt die Verpackung häufig mehr als der Inhalt.
Erich Maria Remarque. Seine Bücher im Nationalsozialismus verboten; seine Schwester von Freisler, einem fanatischen Nationalsozialisten in Richterrobe mit den Worten „Ihr Bruder ist uns entwischt, Sie werden uns nicht entwischen“ ermordet. Nach dem Krieg hatte er – wenig überraschend – kein Interesse an der Wiedererlangung der ihm entzogenen deutschen Staatsbürgerschaft, sein teilweise autobiografischer Roman „Im Westen nichts Neues“ wurde in seiner Wahlheimat USA verfilmt. Jetzt liegt eine unter deutscher Leitung entstandene Bearbeitung für Netflix vor.
Eine Bearbeitung mit mehr Lametta - viel mehr Lametta. Lametta im Bild, Lametta im Storytelling. Im Westen nichts Neues übersetzt in die Ästhetik moderner Computerspiele, die Handlung wie auch die Botschaft vereinfacht statt differenziert.
Neben der opulenten Optik wird auf einfachere Handlungsmuster gesetzt, um ein zu Popcorn passendes blutiges Drama zu liefern. Klischees sind dabei die Engländer der Kommunikation, sei es die allzu offenkundig bereits benutzte Ausrüstung unglücklicher Vorgänger, die Brille des Freundes, das so eben nicht mögliche noch sinnvolle einsammeln der seinerzeit einteiligen Erkennungsmarken oder sich selbst exponierende Flammenwerfer in Zugstärke, es triumphiert das aufgeladene Bild über Logik wie Handlung. Und selbst Paul Bäumers Schicksal letztlich ist an den offenbar unvermeidlichen Antagonisten gebunden; der finale Spannungsbogen des Filmes führt in diesem Fall auch tatsächlich am ursprünglichen Titel vorbei.
Wir gewöhnen uns an das perfekte Bild, die lineare Story, die wie Schnittszenen eines Computerspieles einfach zu produzieren und noch einfacher zu konsumieren ist. Neuronale Netzwerke liefern in hochauflösender Farbe, was zuvor auf unscharfe Grautöne beschränkt war, gerechnete Details einer feuchten Maschinenfantasie werden zur glaubhaften Realität, dabei häufig grösser als das Leben selbst. Und dies gilt für synthetische Geschichten ebenso wie für Gesichter, die es nie gab, Strukturen und Farben die Real erscheinen, aber niemals eine eigene Realität hatten.
13,2 Millionen deutsche Soldaten zwischen 17 und 50 wurden ab August 1914 zum Militärdienst eingezogen. Davon starben jährlich 466.000 Soldaten, insgesamt mehr als 2 Millionen Tote allein im Deutschen Reich. 15% aller eingezogenen Männer fielen, die Jahrgänge zwischen 1892 und 1896 wurden um mehr als ein Drittel förmlich dezimiert. Von den 226.130 Offizieren starb statistisch jeder vierte, junge Frontkommandeure bis zum Range eines Hauptmannes hatten praktisch keine Überlebenschance. (1) Gleichzeitig hungerten die Menschen in der Heimat, die tägliche Kalorienzufuhr sank von 3.400 Kalorien im Jahre 1914 auf 1.000 im Hungerwinter 1917 ab, bei gleichzeitig schlechter Qualität der von Ersatzstoffen geprägten Nahrungsmittelproduktion (2).
Millionen Schicksale, Millionen vermeidbare Tragödien auf allen Seiten eines ebenso mechanisierten wie weltweiten Krieges. Der Netflix Film opfert den Inhalt und die Tiefe der von Remarque erzählten Geschichte zugunsten des preiswerten und mitunter zeitgeistigen Effektes, nur um gleichzeitig den ebenso vernachlässigten Titel als Anti-Kriegs Monstranz vor sich her zu tragen.
Es bleibt die Frage wie Künstler den Schicksalen der Vergangenheit gerecht werden können, gerecht werden wollen. Wie gehen wir mit unserer Geschichte um, erlauben wir uns eine in Wort und Bild differenzierte Herangehensweise oder muss es der pädagogische Holzhammer im Sinne unterhaltsamer Propaganda sein? Otto Dix (Der Krieg, 1932) hatte eine Antwort darauf, Stanley Kubrick (Wege zum Ruhm, 1957) ebenso. Erich Maria Remarque auch. Sein Buch ist wichtig, dieser Film unterhaltsam.
Aus meinem Bücherschrank:
Krieg ist immer ein Elend, daher:
Immanuel Kant - https://amzn.to/3cPIqyb
Karl R. Popper - https://amzn.to/3eqtPd7
Hannah Arendt -https://amzn.to/3CCzPcO
Leo Tolstoi - https://amzn.to/3pXzOIA
Erich M. Remarque - https://amzn.to/3D2h9mP
Manfred Gregor - https://amzn.to/3B92WlJ
Wer Amazon oder Partnerlinks nicht mag, empfohlener Fotobuchshop: https://www.artbooksonline.eu/
[1] Wehler, deutsche Gesellschaftsgeschichte, München, 2003, Bd. 4, S 102 ff
[2] Wehler, deutsche Gesellschaftsgeschichte, München, 2003, Bd. 4, S 70